von Paul Wiegler
Drei Eigenschaften hat man Theodor Fontane gern zugesprochen: er sei durch Abstammung und Ehe ein Berliner Hugenott gewesen und daher ein Künstler des Plauderns; der „Wanderer durch die Mark Brandenburg“; und ein gelassener, im Grunde heiterer Lebensphilosoph. Nichts von alledem trifft genau zu. Dieser Sohn des Neuruppiner Apothekers Louis Henri Fontane hat nach seinem redlichen Geständnis niemals gut französisch gesprochen. Die „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ brachten ihm einen beträchtlichen Erfolg, weil sich in ihnen wiederfand, was Herman Grimm über Prosa solcher Art gesagt hat: „Es scheint über dem Boden eines Landes in unsichtbaren Bildern der Nachglanz einer großen Vergangenheit zu liegen, die wie etwas Erleuchtendes in uns eindringt und uns bei wachenden Augen zu träumen zwingt.“ In Wahrheit hat Fontane nicht so enthusiastisch darüber gedacht. Er habe sogar protestiert und erklärt, er sei kein Verherrlicher der Mark. „Ich habe sagen wollen und wirklich gesagt: Kinder, so schlimm wie ihr es macht, ist es nicht; und dazu war ich berechtigt; aber es ist Torheit, aus diesen Büchern herauslesen zu wollen, ich hätte eine Schwärmerei für Mark und Märker. So dumm war ich nicht.“ Er hat, wie er in einer seiner Anwandlungen von Bosheit behauptete, nur erreichen wollen, „daß ihr, aller Ruppigkeit und Unausstehlichkeit unbeschadet, unter der Vorführung dieser Pflichttrampel und Dienstknüppel einsehen lernet, daß diese letzte Nummer Deutschlands berufen war, seine erste zu werden.“ Wenn Julius Hart andeutete, er sei ein anständiger Kerl, „aber Stockphilister mit einem preußischen Ladestock im Rücken“, so hat ihn das sehr geärgert, da ihn das Romantisch-Phantastische von Jugend auf entzückte und er hierin ein südfranzösisches Erbe sah. Und die Gelassenheit, die Heiterkeit? Des öfteren hat er sie verloren und, ohne es zu zeigen, stets darum kämpfen müssen.
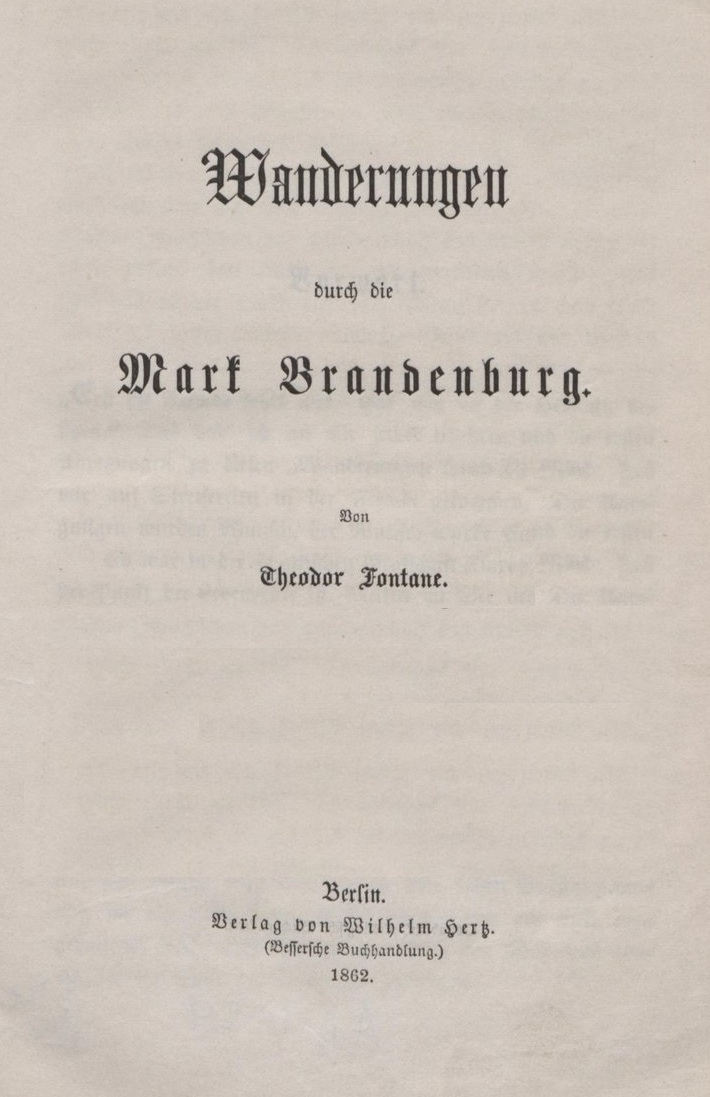
„Kein Verherrlicher der Mark“: Fontane, Wanderungen durch die Mark Brandenburg, Erstausgabe (Titelblatt), 1862
Bildnachweis: Archiv Radecke
Zu verschiedenen Zeitpunkten hat er diese Dissonanzen gebeichtet. Und jedesmal aus dem Vorgefühl und dem Bewußtsein des Alterns heraus. Schon 1856, mit siebenunddreißig Jahren, hat er an Emilie, seine sparsame Frau, die geborene Rouanet, geschrieben: „Daran, daß ich anfange, an Musik Gefallen zu finden, merk’ ich deutlich, daß ich alt werde.“ Mit siebenundfünfzig ist, wie er glaubt, seine irdische Laufbahn fertig. Er hat zwei Orden gekriegt und ist in den Brockhaus gekommen: „Es fehlt nur noch zweierlei, Geheimer Rat und Tod.“ Mit sechzig aber schreibt er an seinen Verleger, und plötzlich ist der Ton wesentlich verändert: „Nichts liegt hinter mir, alles vor mir, ein Glück und ein Pech zugleich. Auch ein Pech. Denn es ist nichts Angenehmes, mit Neunundfünfzig als ein ‚ganz kleiner Doktor‘ dazustehen.“ Im Herbst 1878 nämlich erscheint sein erster Roman, „Vor dem Sturm“, und schnell steigt er auf zum Meister-Erzähler: 1888 „Irrungen, Wirrungen“, 1890 die zweimal durchgearbeitete „Stine“, 1892 „Frau Jenny Treibel“, 1895 „Effi[e] Briest“, bis er Schluß macht mit dem „Stechlin“.
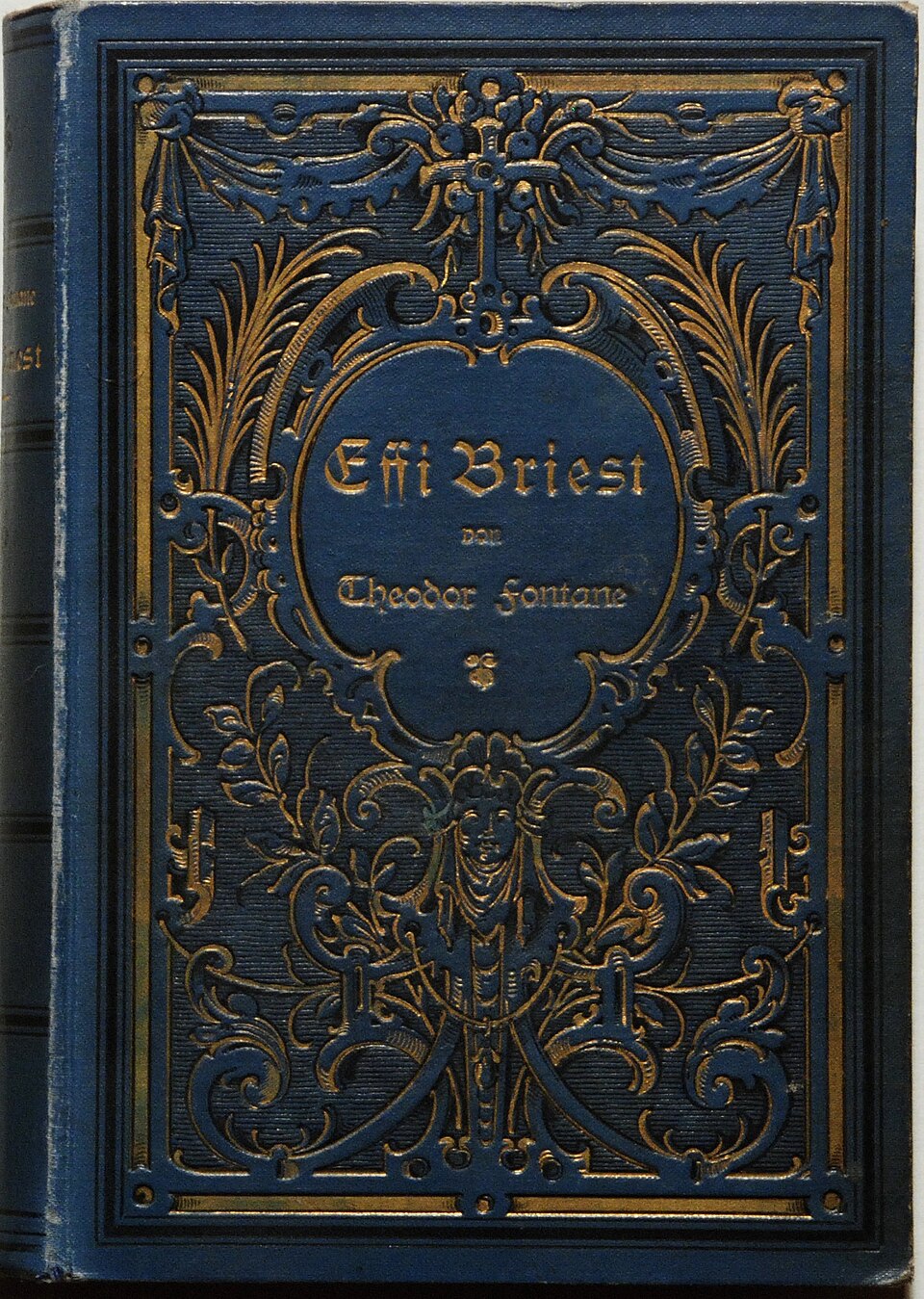
Aufstieg zum „Meistererzähler“: Fontane, Effi Briest, Erstausgabe (Cover), 1896
Bildnachweis: Archiv Radecke
Eines der Worte, die er bevorzugt, wenn er über sich spricht, lautet „drippeln“. Etwa so: „Ich bin gewiß eine dichterische Natur, mehr als tausend andere, die sich selber anbeten, aber ich bin keine große und keine reiche Dichternatur. Es drippelt nur so.“ Ähnlich wie Lessing, als er von seiner Produktivkraft sprach, das Bild von den „Röhren“ gebrauchte. Aber Fontane wußte schon, was in ihm vorging. „Meine ganze Produktion“, bekannte er einmal, „ist Psychographie und Kritik, Dunkelschöpfung im Lichte zurechtgerückt.“ Und dabei verhehlte er nicht, „daß ich diese ganze Novelle mit halber und Viertel Kraft geschrieben habe.“ Psychographie: ein auffälliger und tiefgreifender Ausdruck für das Positive seiner Arbeitsmethode. Man vergesse nicht, daß der Alte unter die Erzähler der neuen Generation eingereiht wurde, als er den Roman ohne ein Wort über den geheimen Ehebruch, die „Effi[e] Briest“, schrieb. Die „Mathilde Möhring“ war Psychographie, der von ihm nicht veröffentlichte kleine Roman der Berliner Zimmervermieterin in der Georgenstraße, und die Szenen der „Poggenpuhls“ waren es.
Man hat gefragt, ob er ein Dichter der Frau gewesen sei, als romantisierender und sentimentalisierender Troubadour, wenn er auch eine ritterliche Leidenschaft für eine Tote hatte, für die junge Königin Mary Stuart. In der „Frau Jenny Treibel“ galt ihm wenig das Weibliche. Er hat den Frauenfiguren, für die er etwas übrig hatte, mit Einschluß der „Cécile“ und der Christine Holk in „Unwiederbringlich“, gewissermaßen nachgerühmt, sie hätten „einen Knacks weggehabt“. Er verliebte sich in sie, wie er mit Freimut sagte, „nicht um ihrer Tugenden, sondern um ihrer Menschlichkeiten, das heißt um ihrer Schwächen und Sünden willen“. Melusinen, so bezeichnete er sie wohl, und eine Melusine gibt es noch im „Stechlin“, in dem sie eine Art von Räsonneur ist, sich abhebend von ihrer Armgard und Dubslavs Schwester, der Stiftsdomina, und wo Dubslav, „still in seinem alten Herzen“, über sie äußert: „Das ist eine Dame und ein Frauenzimmer dazu. So müssen Weiber sein.“
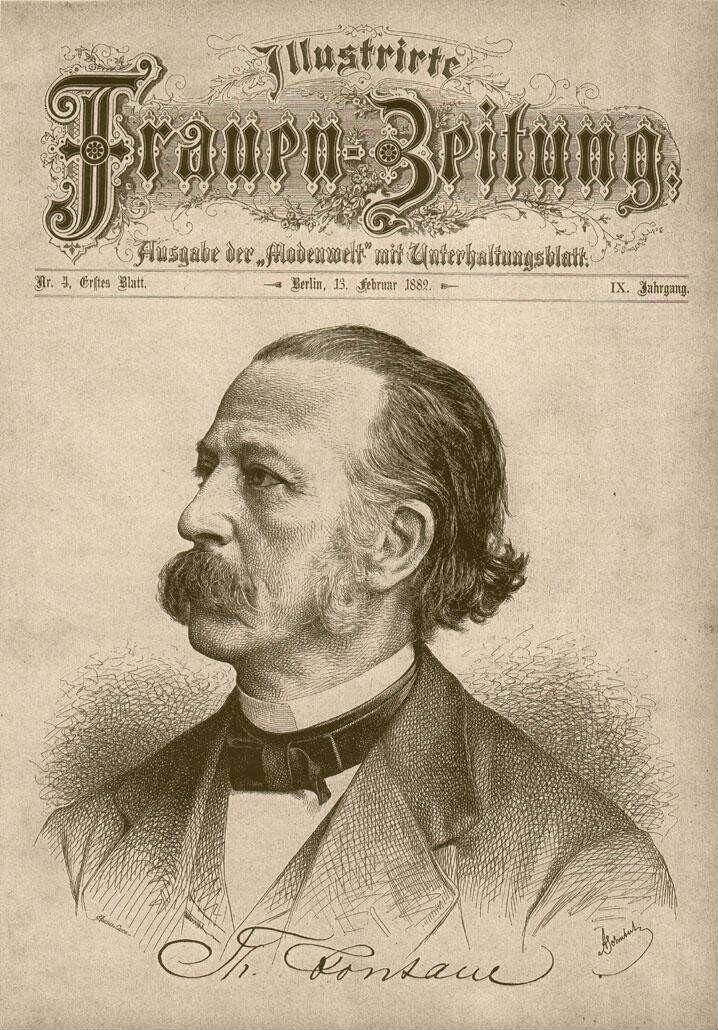
„Ein Dichter der Frau“? Illustrirte Frauen-Zeitung (Titelblatt), 1882
Bildnachweis: Deutsche Digitale Bibliothek
Fontane, der 1898 gestorben ist, hatte 1895 wieder einen historischen Roman geplant, den Störtebe[c]ker-Roman der „Likedeeler“. Der sollte eine groteske Tragödie sein, humoristisch wie die „Hosen des Herrn von Bredow“, und „überhaupt von allem Dagewesenen abweichen“: Jedoch das Unternehmen scheiterte, der „Weitsprung“ gelang ihm nicht. Von dem Hause Potsdamerstraße 134 c ging Theodor Fontane, in einen Schal Gehüllt, jahrzehnte lang täglich dem Potsdamer Tor zu. Er gehörte zu den Honoratioren des Bezirks gerade so wie Menzel, der täglich im Weinrestaurant von Frederich speiste und noch unter die Spätpassanten sich mischte, nicht ohne grimmige Musterung der Königinnen der Nacht. Aber Fontane war müde geworden, und eines Tages wurde er bettlägerig und verschwand von der Potsdamerstraße.
Man weiß, wie er sich noch als Siebziger in der Vossischen Zeitung für das „fabelhafte Stück eines Herrn Gerhart Hauptmann“ eingesetzt hat, für „Vor Sonnenaufgang“. Hauptmann schien ihm neben Ibsen „bloß ein Kadett“, aber ein Dichter, der „mal wirklich einer ist und ein Mensch dazu“. Der Fünfundsiebzigjährige hatte sogar seine instinktive Abneigung gegen Strindberg überwunden, den er nach der „Beichte eines Toren“, wenn die zur Rache geschrieben sei, einen „Schofelinski“ genannt hatte. Als er dahinschied, trat er den Jungen befreundet vom Schauplatz. Niemand hat ihn so beklagt wie die Realisten und Sozialisten. „Unsere Enkel werden erst die wirkliche Schlacht zu schlagen haben“, das war sein Vermächtnis für die Nachkommen der Revolutionäre des „Scharmützels“, des Aufruhrs von 18. März 1848.
Zum Autor: Paul Wiegler (* 1878 in Frankfurt/M. – †1949 in Berlin), Schriftsteller, langjähriger Lektor des Berliner Ullstein Verlags, Journalist und Übersetzer. Zählte zu den einflussreichsten belletristischen Lektoren und Förderern von Schriftstellern in den 1920er-Jahren. Veröffentlichte einen Roman, „Das Haus an der Moldau“ (1934), in dem er anhand eines Prager Juristen den Zerfall der österreichisch-ungarischen Monarchie erzählt. Sein Nachlass wird im Literaturarchiv der Akademie der Künste, Berlin, aufbewahrt.
Quelle
- Paul Wiegler, Der alte Fontane [Typoskript]; in: Paul-Wiegler-Archiv, Akademie der Künste, Nr. 487.
- Der Text wurde für die Tageszeitung Neues Deutschland redaktionell bearbeitet und minimal gekürzt unter dem Titel „Der alte Theodor Fontane. Zu seinem 50. Todestag am 20. September“ veröffentlicht. Vgl. Neues Deutschland, Nr. 219, 19. September 1948.
Titelbild
- Paul Wiegler, Porträt, unbekannter Fotograf, Bildnachweis: Akademie der Künste, Berlin
Weitere Beiträge zu Fontanes Rezeption:

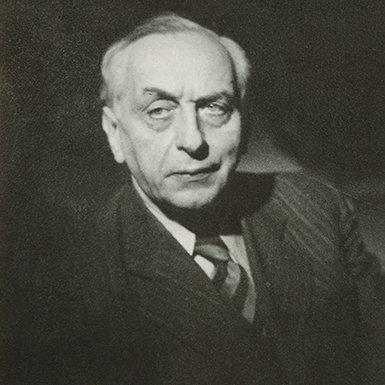
Wunderbar leichtfüßig geschrieben und sehr viel Neues erfahren; ja so liest man es gern. Paul W. war mir überhaupt nicht bekannt. Hoffe, ihr bekommt viele Leser.